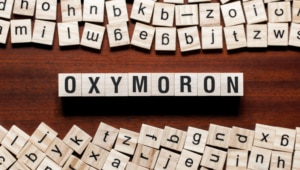Enjambement: 5 Arten, 6 Wirkungen + 3 Beispiele für das Stilmittel
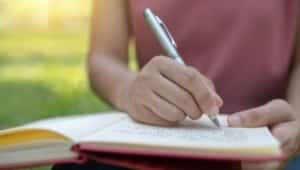
Das Enjambement ist ein Stilmittel, das häufig in lyrischen Texten wie dem Gedicht verwendet wird, aber eher selten erkannt wird. Die erzeugte Wirkung hängt dabei stark von dem Kontext ab. Wir zeigen dir, was ein Enjambement ist, welche Wirkungen es haben kann und wie du es leicht erkennen kannst.
Das rhetorische Mittel Enjambement ist auch als Zeilensprung bekannt. Du findest es vor allem im Gedicht und es ist relevant für Interpretationen in der Schule sowie für Haus- und Abschlussarbeiten in sprachwissenschaftlichen und philosophischen Studiengängen.
Definition: Was ein Enjambement ist

Was ein Enjambement ist
Das Enjambement, auch Zeilensprung oder Versbrechung genannt, ist ein lyrisches Stilmittel, das ausschließlich in der geschriebenen Sprache Anwendung findet.
Der Begriff Enjambement stammt aus dem Französischen. Das Wort kommt von dem Verb enjamber, das auf Deutsch überspringen bedeutet. Die Aussprache wird ebenfalls aus dem Französischen übernommen [ɑ̃ʒɑ̃(bə)ˈmɑ̃ː].
Das Stilmittel Enjambement bezeichnet die Fortführung eines Satzes über einen Vers oder eine Zeile hinaus. Der Satz wird quasi an Ende eines Verses oder einer Zeile unterbrochen, und anschließend im nächsten Vers oder der nächsten Zeile fortgesetzt.
Ein Beispiel für diesen Zeilensprung ist:
- Ich spazierte durch den nebeligen Wald
und fürchtete mich vor der Dunkelheit.
Arten von Enjambements
In der Regel reicht es in einer Gedichtanalyse, ein Enjambement generell zu erkennen. Das Stilmittel lässt sich darüber hinaus differenzieren.
Man unterscheidet zwischen harten beziehungsweise starken Enjambements, weichen beziehungsweise schwachen Enjambements, morphologischen Enjambements und Strophenenjambements. Es hängt von den Versgrenzen ab, welche Form des Zeilensprungs vorliegt.
Schwaches Enjambement
Ein schwaches Enjambement, auch bekannt als weiches Enjambement, unterbricht zwar einen Satz, jedoch keine syntaktische Einheit. Eine syntaktische Einheit bezeichnet eine Einheit, die sprachlich unmittelbar zusammengehört und eigentlich nicht getrennt wird.
In unserem Beispiel bilden die Wörter nebeligen und Wald eine syntaktische Einheit, da sich das Adjektiv direkt auf das Substantiv bezieht. Ein Beispiel für ein weiches Enjambement ist also:
- Ich spazierte durch den nebeligen Wald
und fürchtete mich vor der Dunkelheit.
Die Einheit nebeligen Wald bleibt unberührt, da der Satz vor dem Bindewort und getrennt wird. Beim Lesen pausiert man also nach der syntaktischen Einheit, was den Lesefluss aber nicht großartig stört.
Starkes Enjambement

Starkes Enjambement
Ein starkes oder auch hartes Enjambement hingegen zeichnet sich dadurch aus, dass es syntaktische Einheiten durchbricht. Unser Beispiel mit einem harten Enjambement würde also wie folgt aussehen:
- Ich spazierte durch den nebeligen
Wald und fürchtete mich vor der Dunkelheit.
Beim Lesen merkt man, dass man etwas stockt und dass das Durchbrechen der syntaktischen Einheit den Lesefluss deutlich beeinträchtigt.
Morphologisches Enjambement
Das morphologische Enjambement geht einen Schritt weiter und trennt am Versende ein einziges Wort. In unserem Beispiel könnte das so aussehen:
- Ich spazierte durch den nebe-
ligen Wald und fürchtete mich
vor der Dunkelheit.
Strophenenjambement
Eine weitere Sonderform ist das Strophenenjambement, bei dem der Zeilensprung nicht nur zwischen zwei Versen, sondern zwischen ganzen Strophen erfolgt. Ein Satz wird also über die Grenze einer Strophe weitergeführt. Ein Beispiel dafür ist:
- Ich spazierte
durch den nebeligen Wald
und fürchtete mich vor der Dunkelheit,
die mich nachts nicht schlafen lässt.
Ich liege schlaflos in meinem Bett.
Hakenstil
Als Hakenstil wird eine Folge von Enjambements bezeichnet. Die Häufung der Enjambements verstärkt dementsprechend den jeweiligen Effekt, den sie in einem Gedicht haben.
Wenn jeder Vers aus einem Satz gebildet wird, liegt hingegen der klassische Zeilenstil vor. Im Gegensatz zum Hakenstil sind die Verse also durch Satzzeichen am Ende aller Zeilen getrennt und jeder Vers bildet alleine eine Sinneseinheit.
Wirkungen von Enjambements

Wirkung des Enjambements
Enjambements finden meistens in Gedichten Anwendung, können aber auch als stilistisches Mittel in Prosatexten verwendet werden.
Die Wirkung, die ein Enjambement erzeugt, hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Enjambements, der Rhythmik und der Stimmung. Folgende Wirkungen von Enjambements kann man häufig entdecken.
Die 30 wichtigsten rhetorischen Mittel und ihre Wirkung findest du hier.
Zwiespalt untermalen
Ein Enjambement kann einen Zwiespalt untermalen. Während ein Versende einen Abschluss beziehungsweise eine Pause erzeugt und ihn so klar vom nächsten Vers trennt, kann mit einem Enjambement eine Verbindung erzeugt werden.
Das Stilmittel verdeutlich also, dass zwischen den beiden Versen weder eine eindeutige Trennung, noch eine ununterbrochene Verbindung besteht. Es symbolisiert also sowohl einen Bruch als auch eine bestehende Zusammengehörigkeit.
Stockende Wirkung
Wenn das Enjambement bewirkt, dass das Gedicht als stockend wahrgenommen wird, kann das den Inhalt des Gedichts dementsprechend verstärken. Das ist meistens der Fall, wenn vermehrt männliche Kadenzen vorliegen, also wenn die Verse auf eine betonte Silbe enden.
Dabei bewirkt vorwiegend das starke Enjambement, und sogar noch stärker das morphologische Enjambement, dass der Lesefluss gestört wird und ein Stocken erzeugt wird.
Das kann den Inhalt beziehungsweise die Atmosphäre der jeweiligen Verse verstärken. In diesem Fall kann durch den gezielten Einsatz eines Enjambements unter anderem eine unangenehme, holprige und verwirrende Wirkung erzielt werden.
Lautmalerei
Zudem kann speziell ein morphologisches Enjambement den Wortsinn eines einzelnen Wortes verstärken beziehungsweise veranschaulichen. Beim Lesen der entsprechenden Verse kann so der Inhalt durch Lautmalerei dargestellt werden. Ein Beispiel dafür ist die Trennung des Wortes stolpert:
- Der alte Mann stol-
pert die Treppe herunter.
Fließende Wirkung

Ein Enjambement kann eine fließende Wirkung haben
Während das starke und das morphologische Enjambement eher stockend wirken, kann das schwache Enjambement den Lesefluss verbessern. Das ist vorwiegend dann der Fall, wenn weibliche Kadenzen vorliegen, also wenn die Verse auf eine unbetonte Silbe enden. Das treibt den Text vorwärts und erzeugt weiche Übergänge.
Der Einsatz weicher Enjambements kann also die Atmosphäre verstärken und eine angenehme, fließende, fortlaufende oder sogar treibende Wirkung erzielen.
Struktur aufbrechen
Was außerdem zur Verbesserung des Leseflusses beiträgt, ist, dass schwache Enjambements das Gedicht mit den nötigen Pausen versehen können. Wenn ein Gedicht viele lange Sätze enthält, signalisieren die Versenden an geeigneten Stellen Pausen und erleichtern das Lesen.
Strophen verbinden
Strophenenjambement haben ebenfalls einen Effekt auf die Struktur des Gedichtes. Sie verbinden einzelne Strophen miteinander und bewirken damit, dass die Pausen zwischen den Strophen verkürzt werden und erzeugen quasi eine Brücke zwischen den Einheiten. So kann eine inhaltliche Verbindung zwischen zwei eigentlich eindeutig voneinander getrennten Elementen geschaffen werden.
Enjambement erkennen: Beispiele für das Stilmittel

Enjambement erkennen: Beispiele für das Stilmittel
Enjambements finden häufig in der Lyrik Anwendung. Im Folgenden zeigen wir dir bekannte Beispiele, die dir das Stilmittel verdeutlichen. Überlege beim Lesen, welche Art von Enjambement vorliegt und welche Wirkung es erzeugt.
Beispiel für ein Enjambement
Herbst im Fluss
Der Strom trug das ins Wasser gestreute
Laub der Bäume fort.
Ich dachte an alte Leute
Die auswandern ohne ein Klagewort.
Die Blätter treiben und trudeln,
Gewendet von Winden und Strudeln
Gezügig, und sinken dann still.
Wie jeder, der Großes erlebte,
Als er an Größerem bebte,
Schließlich tief ausruhen will.
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Beispiel für ein Strophenenjambement
Abendphantasie
Vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitzt
Der Pflüger; dem Genügsamen raucht sein Herd.
Gastfreundlich tönt dem Wanderer im
Friedlichen Dorfe die Abendglocke.
Wohl kehren izt die Schiffer zum Hafen auch,
In fernen Städten, fröhlich verrauscht des Markts
Geschäft’ger Lärm; in stiller Laube
Glänzt das gesellige Mahl den Freunden.
Wohin denn ich? Es leben die Sterblichen
Von Lohn und Arbeit; wechselnd in Müh und Ruh
Ist alles freudig; warum schläft denn
Nimmer nur mir in der Brust der Stachel?
Am Abendhimmel blühet ein Frühling auf;
Unzählig blühn die Rosen und ruhig scheint
Die goldne Welt; o dorthin nehmt mich,
Purpurne Wolken! und möge droben
In Licht und Luft zerrinnen mir Lieb und Leid! –
Doch, wie verscheucht von höriger Bitte, flieht
Der Zauber; dunkel wird’s und einsam
Unter dem Himmel, wie immer, bin ich –
Komm du nun, sanfter Schlummer! zu viel begehrt
Das Herz; doch endlich, Jugend! verglühst du ja,
Du ruhelose, träumerische!
Friedlich und heiter ist dann das Alter.
Friedrich Hölderlin (1770-1843)
Dieses Gedicht enthält einige Enjambements. Hervorzuheben ist hier das Strophenenjambement zwischen der vierten und der fünften Strophe, das den Zwiespalt beziehungsweise den Gegensatz an dieser Stelle hervorhebt.
Sowohl in der vierten als auch in der fünften Strophe wird der Abendhimmel beschrieben. Das Enjambement verdeutlicht diese Verbindung der beiden Strophen.
In der vierten Strophe wird der Abendhimmel jedoch zunächst durch seine äußerlichen, schönen Seiten beschrieben, während in der fünften Strophe im Gegensatz dazu das subjektive Empfinden des lyrischen Ichs dargestellt wird. Das lyrische Ich wird sich seiner Einsamkeit bewusst.
Beispiel für den Hakenstil
Städter
Dicht wie die Löcher eines Siebes stehn
Fenster beieinander, drängend fassen
Häuser sich so dicht an, dass die Straßen
Grau geschwollen wie Gewürgte stehn.
Ineinander dicht hineingehakt
Sitzen in den Trams die zwei Fassaden
Leute, ihre nahen Blicke baden
Ineinander, ohne Scheu befragt.
Unsre Wände sind so dünn wie Haut,
Dass ein jeder teilnimmt, wenn ich weine.
Unser Flüstern, Denken … wird Gegröle …
Und wie still in dick verschlossner Höhle
Ganz unangerührt und ungeschaut
Steht ein jeder fern und fühlt: alleine.
Alfred Wolfenstein (1883-1945)
Anzeichen für ein Enjambement

Anzeichen für ein Enjambement
Um ein Enjambement bei einer Gedichtanalyse zu erkennen musst du darauf achten, ob die Verse ausschließlich im Zeilenstil verfasst sind, also ob jeder Vers aus einem Satz gebildet wird, oder ob es auch Sätze gibt, die über mehrere Verse laufen. Bei Letzterem liegt nämlich ein Enjambement vor.
In den meisten Fällen kannst du einen einzelnen Satz im Zeilenstil daran erkennen, dass der Vers allein eine Sinneseinheit bildet und mit einem Satzzeichen am Ende des Verses endet.
Ein Enjambement zeichnet sich also dadurch aus, dass mehrere Verse eine Sinneseinheit bilden und dass sich in der Regel kein Satzzeichen zwischen den zusammengehörigen Versen steht.
Wenn du ein Gedicht auf Enjambements untersuchst, solltest du zudem überprüfen, ob es sich um ein einzelnes oder einige wenige, verteilte Enjambements handelt, oder ob mehrere in Folge vorkommen. In dem Fall solltest du den Hakenstil erkennen und nennen.